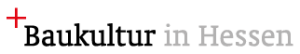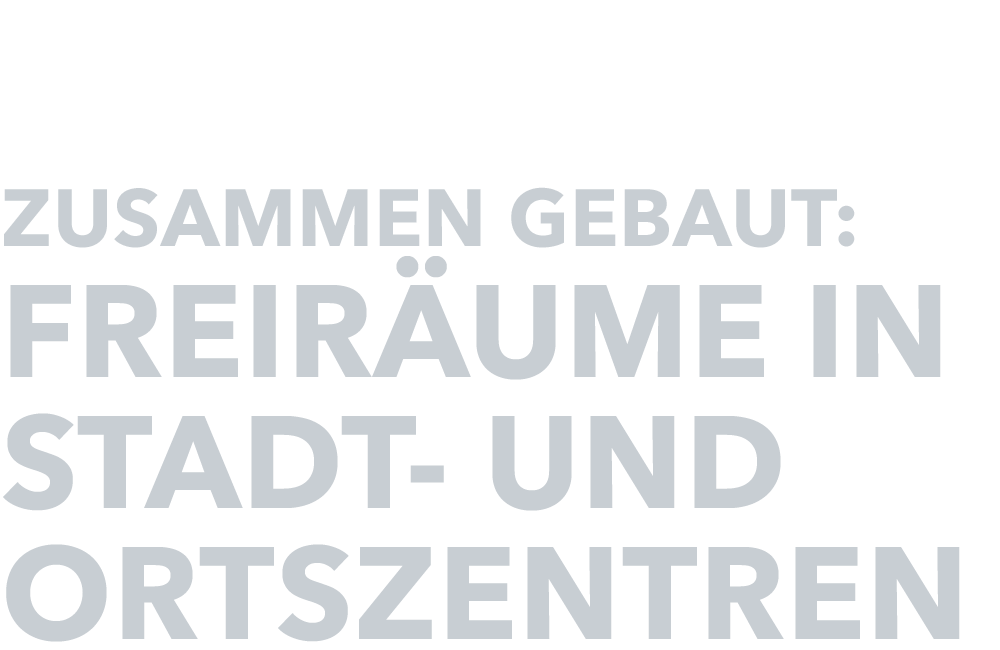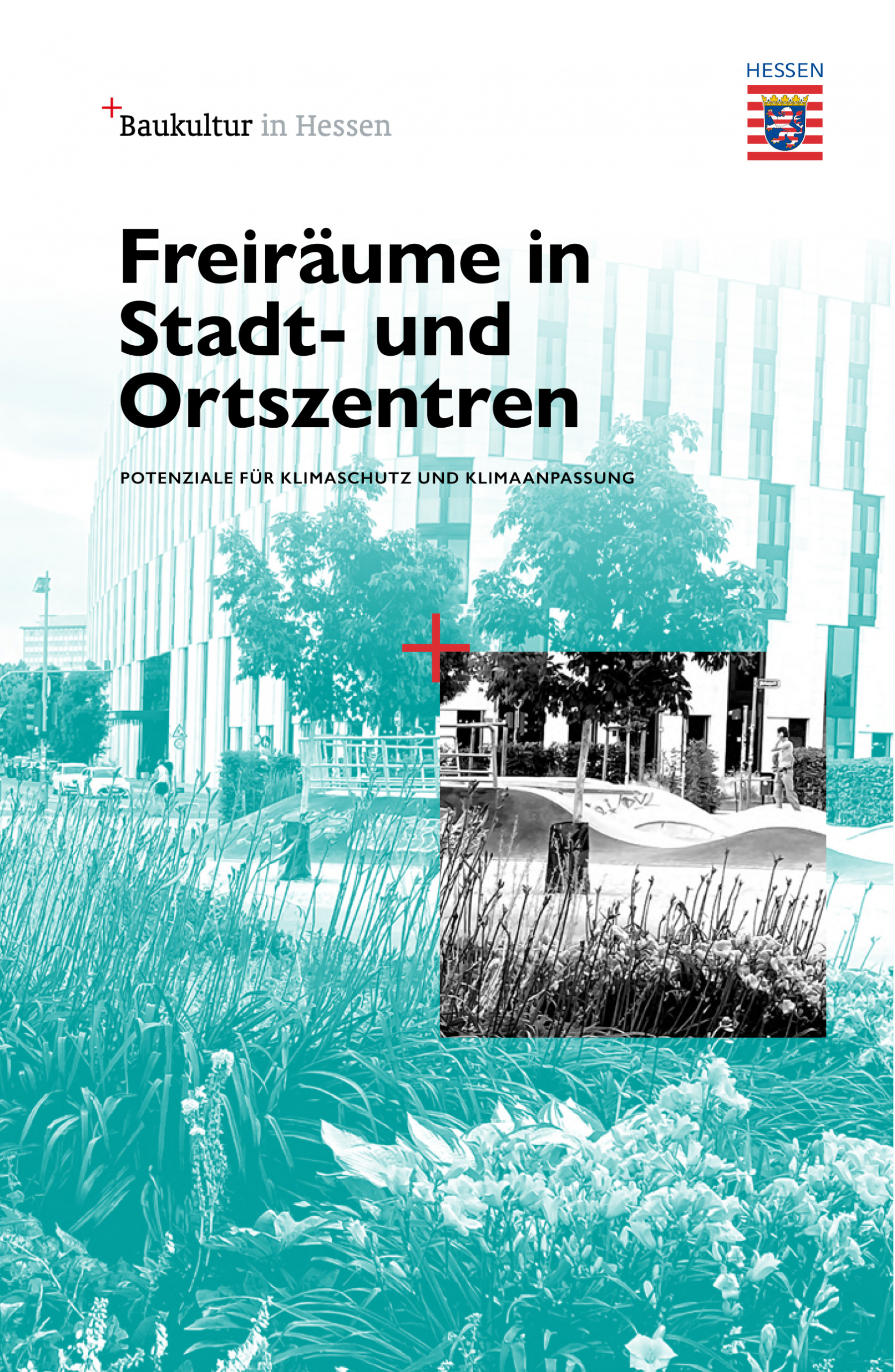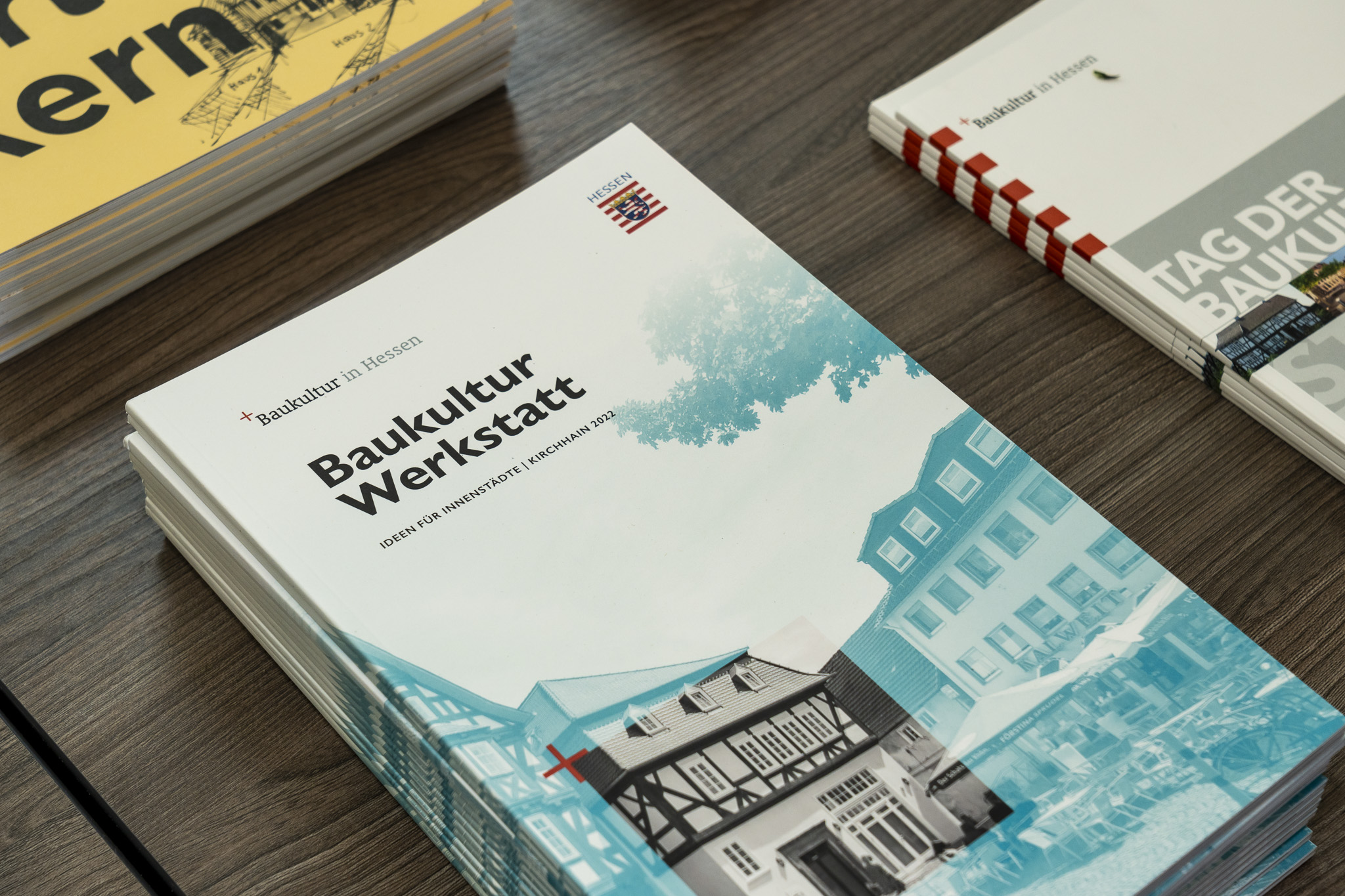Hessischer Landespreis Baukultur
2022/2023
ZUSAMMEN GEBAUT –
Freiräume in Stadt- und Ortszentren
Freiräume in Stadt- und Ortszentren – Potenziale für Klimaschutz und Anpassung
Das sechste Auszeichnungsverfahren der Reihe ZUSAMMEN GEBAUT der Landesinitiative +Baukultur in Hessen widmet sich der Innenentwicklung und dabei den öffentlichen Freiräumen in den hessischen Innenstädten und Ortszentren. Pflanzen in allen Facetten spielen dabei eine wesentliche Rolle, aber auch Wasser, bauliche Schattenspender oder temporäre Bauten sowie experimentelle Interventionen zu Aufenthaltsqualität und Klimafolgenanpassung.
Es wurden Projekte gesucht, die zeigen, wie vielschichtige und gut gestaltete Freiräume zu Aufenthaltsqualität und Wohlbefinden in den Zentren der Städte und Gemeinden beitragen und gleichzeitig die Folgen des Klimawandels abmildern oder zur Artenvielfalt beitragen.
Eingereicht werden konnten sowohl Neubau-, Umbau- und Modernisierungsprojekte als auch temporäre Projekte und Interventionen. Studierende waren ausdrücklich eingeladen, in einer eigenen Kategorie am Verfahren teilzunehmen.
Weitere Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Bewertungskriterien, Organisation, Jury und Auszeichnung rund um den Hessischen Landespreis Baukultur finden Sie im Online-Bewerbungsportal. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich. Das Verfahren ist abgeschlossen.
Preisträgerinnen und Preisträger 2023:
Im Rahmen der Preisverleihung am 6. Juli 2023 ab 15 Uhr auf dem Gelände der Landesgartenschau in Fulda erhielten folgende Beiträge einen gleichrangigen ersten Preis:
- Landschaftstreppe Ludwigshöhviertel, Darmstadt
BVD New Living GmbH & Co. KG (Bauherr) mit Sommerlad Haase Kuhli Landschaftsarchitekten PartG mbB - Rennbahnpark, Frankfurt am Main
BHM Planungsgesellschaft mbH
- Mainufer Frankfurt an der ehemaligen Ruhrorter Werft, Frankfurt am Main
BIERBAUM.AICHELE.landschaftsarchitekten Part.GmbB
- Neugestaltung des Parkes am Blaubach, Geisenheim
Magistrat der Hochschulstadt Geisenheim mit der Hochschule Geisenheim University, Entwurf und Planung – Martina und Kai Faust Freigestaltung per se – künftig Faust Freigestaltung, Ausschreibung und Baubetreuung – Waldvogel Landschaftsarchitektur - Bildungs- und Sportcampus, Bürstadt
Drees & Sommer